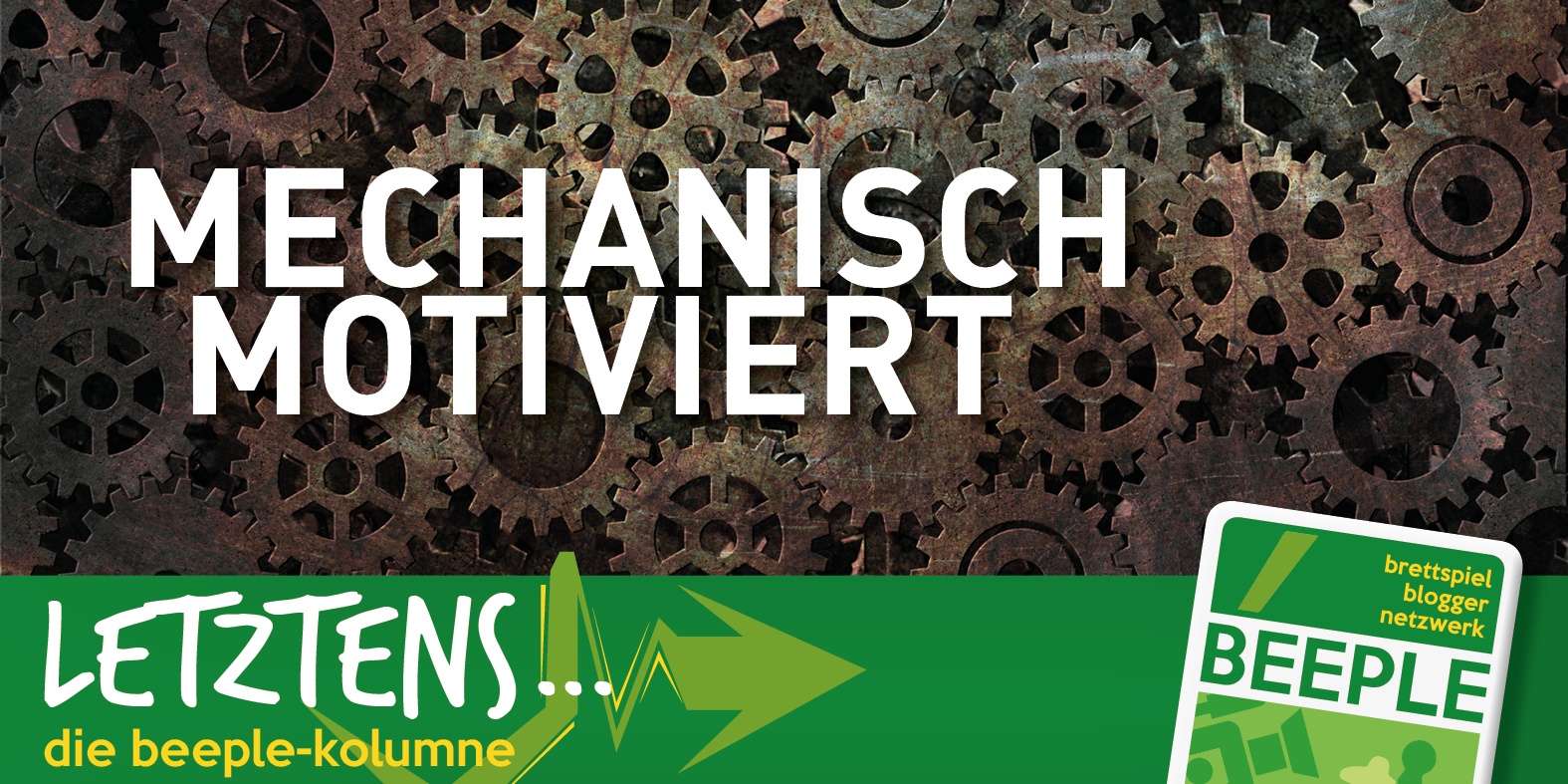Mechanisch motiviert
 Letztens kam mir der Gedanke, dass ich wohl eine generelle Abneigung gegen meine Mitmenschen hege. Wie sonst ist es zu erklären, dass ich es mehr und mehr genieße, Brettspiele auf den Tisch zu packen und sie dann ganz allein zu spielen? Nach zweieinhalb Jahren meines „Brettspiel-Podcasts zum Thema Solo-Spiele“ bin ich als Solo-Spieler nicht mehr ganz unbekannt in der Szene. Somit kenn ich natürlich auch die ganzen Sprüche: „Bevor ich ein Brettspiel allein spiele, mach ich doch lieber die Playstation an“, „Wenn man keine Freunde hat, muss man eben solo spielen“, „Schön dass Du da bist, wir haben Dir schon einen Einzeltisch zum Spielen reserviert“, „Ich würde nie allein spielen, Spiele leben doch von der Interaktion mit anderen Menschen“, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Als „good sport“ nehme ich sie alle mit einem freundlichen Lächeln hin und schieße irgendeinen Spruch zurück, falls mir gerade etwas Kluges einfällt.
Letztens kam mir der Gedanke, dass ich wohl eine generelle Abneigung gegen meine Mitmenschen hege. Wie sonst ist es zu erklären, dass ich es mehr und mehr genieße, Brettspiele auf den Tisch zu packen und sie dann ganz allein zu spielen? Nach zweieinhalb Jahren meines „Brettspiel-Podcasts zum Thema Solo-Spiele“ bin ich als Solo-Spieler nicht mehr ganz unbekannt in der Szene. Somit kenn ich natürlich auch die ganzen Sprüche: „Bevor ich ein Brettspiel allein spiele, mach ich doch lieber die Playstation an“, „Wenn man keine Freunde hat, muss man eben solo spielen“, „Schön dass Du da bist, wir haben Dir schon einen Einzeltisch zum Spielen reserviert“, „Ich würde nie allein spielen, Spiele leben doch von der Interaktion mit anderen Menschen“, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Als „good sport“ nehme ich sie alle mit einem freundlichen Lächeln hin und schieße irgendeinen Spruch zurück, falls mir gerade etwas Kluges einfällt.
Doch vor allem der Kommentar zur „Interaktion mit anderen Menschen“ hat mich dann wieder zum Nachdenken gebracht. Können wir Brettspiele wirklich nur dann genießen, wenn die Gesellschaft anderer am Tisch gegeben ist? Immerhin sprechen wir übergeordnet von „Gesellschaftsspielen“. Steckt ja im Namen. Also sollte man sie wohl nur in Gesellschaft spielen, korrekt? Das ist ein Argument, das ich ungefähr genauso nachvollziehen kann, wie die Enttäuschung des Spieleneulings, der nach dem Öffnen der „Dominion“-Schachtel feststellen musste, dass man bei diesem „Brettspiel“ doch glatt vergessen hat, das Spielbrett beizulegen. Nomen est omen? Von wegen … Lassen wir die Label, die irgendwann mal jemand festgelegt hat, also lieber außen vor. Nichtsdestotrotz kann man der Aussage, dass Spiele von der Interaktion mit anderen Menschen leben, ihren Wahrheitsgehalt nicht absprechen. Wenn wir gemeinsam spielen, interagieren wir auf sozialer Ebene. Wir reden, wir lachen, wir diskutieren, wir stoßen an, wir „high-fiven“, wir genießen einfach das Beisammensein und müssen dazu nicht mal ein Top-Spiel auf dem Tisch liegen haben. Das alles ist schön und gut und kann durch keinen noch so cleveren Solo-Modus reproduziert werden.
 Dann ist mir jedoch klar geworden, dass man dieser sozialen Interaktion etwas gegenüberstellen muss, das ich hier einfach mal „mechanische Interaktion“ nenne. Das ist die Interaktion, die vom Spiel selbst vorgegeben wird: Wie werden meine Aktionsmöglichkeiten im Spiel durch die Aktionen meiner Mitspieler beeinflusst? Wir teilen uns die Plättchen, die Karten, die Aktionsplätze. Wenn mein Mitspieler mir etwas vor der Nase wegschnappt, das ich unbedingt haben wollte, gerät mein lang gehegter Plan ins Wanken und ich muss schnell umdenken. Klar, das sorgt für Spannung und Ungewissheit und bedingt ein gewisses Maß an Anpassungvermögen. Doch im Gegensatz zur sozialen kann man diese mechanische Interaktion durch mehr oder weniger raffinierte Automatismen im Solo-Spiel sehr gut nachbilden, vor allem dann, wenn sich der mechanische Mehrwert zusätzlicher Mitspieler sowieso in Grenzen hält.
Dann ist mir jedoch klar geworden, dass man dieser sozialen Interaktion etwas gegenüberstellen muss, das ich hier einfach mal „mechanische Interaktion“ nenne. Das ist die Interaktion, die vom Spiel selbst vorgegeben wird: Wie werden meine Aktionsmöglichkeiten im Spiel durch die Aktionen meiner Mitspieler beeinflusst? Wir teilen uns die Plättchen, die Karten, die Aktionsplätze. Wenn mein Mitspieler mir etwas vor der Nase wegschnappt, das ich unbedingt haben wollte, gerät mein lang gehegter Plan ins Wanken und ich muss schnell umdenken. Klar, das sorgt für Spannung und Ungewissheit und bedingt ein gewisses Maß an Anpassungvermögen. Doch im Gegensatz zur sozialen kann man diese mechanische Interaktion durch mehr oder weniger raffinierte Automatismen im Solo-Spiel sehr gut nachbilden, vor allem dann, wenn sich der mechanische Mehrwert zusätzlicher Mitspieler sowieso in Grenzen hält.
Ein Blick in mein Spieleregal hat mir dann bestätigt, dass das genau die Art von Spielen ist, die mir solo am meisten Spaß bereiten. Und zwar meine ich damit all jene Euro-Strategiekracher, die gern ganz liebevoll als „seelenlose Klötzchenschieber“ bezeichnet werden. Im Solo-Modus zu „Blackout: Hong Kong“ beispielsweise wird einer der wenigen Interaktionspunkte, die Auslage an erwerbbaren Personenkarten, dadurch simuliert, dass ein Teil der Karten am Rundenende weggeräumt wird, ganz so, als hätten sie mir die nicht anwesenden Mitspieler weggekauft. In „Ein Fest für Odin“ lasse ich die von mir eingesetzten Arbeiter für die Folgerunde einfach stehen, so dass ich mich sozusagen eine Runde lang selbst blockiere. Und in „Maracaibo“ sorgt ein über ein dezidiertes Kartendeck gesteuerter „virtueller“ Gegner dafür, dass meine Rundfahrt durch die Karibik zu einem heißen Wettrennen wird, das immer dann ein Ende hat, wenn ich noch nicht mal die Hälfte von dem erledigen konnte, was ich vorhatte. Diesem Kartendeck ist es freilich herzlich egal, wenn ich dem Frust ob dieses perfiden Durchkreuzens meiner Pläne lauthals freien Lauf lasse. Da fehlt dann natürlich die direkte Reaktion des menschlichen Gegenspielers, der mir mit einem triumphierenden Lächeln klarmachen würde, dass er diese Gemeinheit gerade so richtig auskostet. Diese zusätzliche Ebene an „Menschlichkeit“ vermisse ich beim Solo-Spielen selbstverständlich schon. Rein mechanisch betrachtet macht es an der Stelle jedoch kaum einen Unterschied, ob mein Mitspieler in menschlicher oder in kartengesteuerter Form anwesend ist. Klingt böse, ich weiß. Aber es ist nun mal so, dass menschliche Mitspieler bei dieser Art von Spielen hauptsächlich die Spielzeit und die allseits gefürchtete „Downtime“ erhöhen. Und das schöne ist doch, dass ich, wenn ich allein spiele, selber kein schlechtes Gewissen haben muss, für Downtime bei anderen zu sorgen. Ich kann mir so viel Zeit lassen wie ich will und meine Züge bis ins letzte Detail durchoptimieren. „Das Hirn muss rauchen“, heißt es so schön. Und das tut es nun mal viel effizienter, wenn ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle.
Es ist also wahr, dass meine Leidenschaft für Solo-Spiele auf eine gewisse „Interaktionsskepsis“ zurückzuführen ist. Allerdings kann ich für mich beruhigt konstatieren, dass das wohl doch nichts mit einer Abneigung gegen meine Mitmenschen zu tun hat. Als Alleinspieler bin ich einfach durch und durch mechanisch motiviert.
Sebastian Schmieder (www.solomanolo.de), 30.5.2020